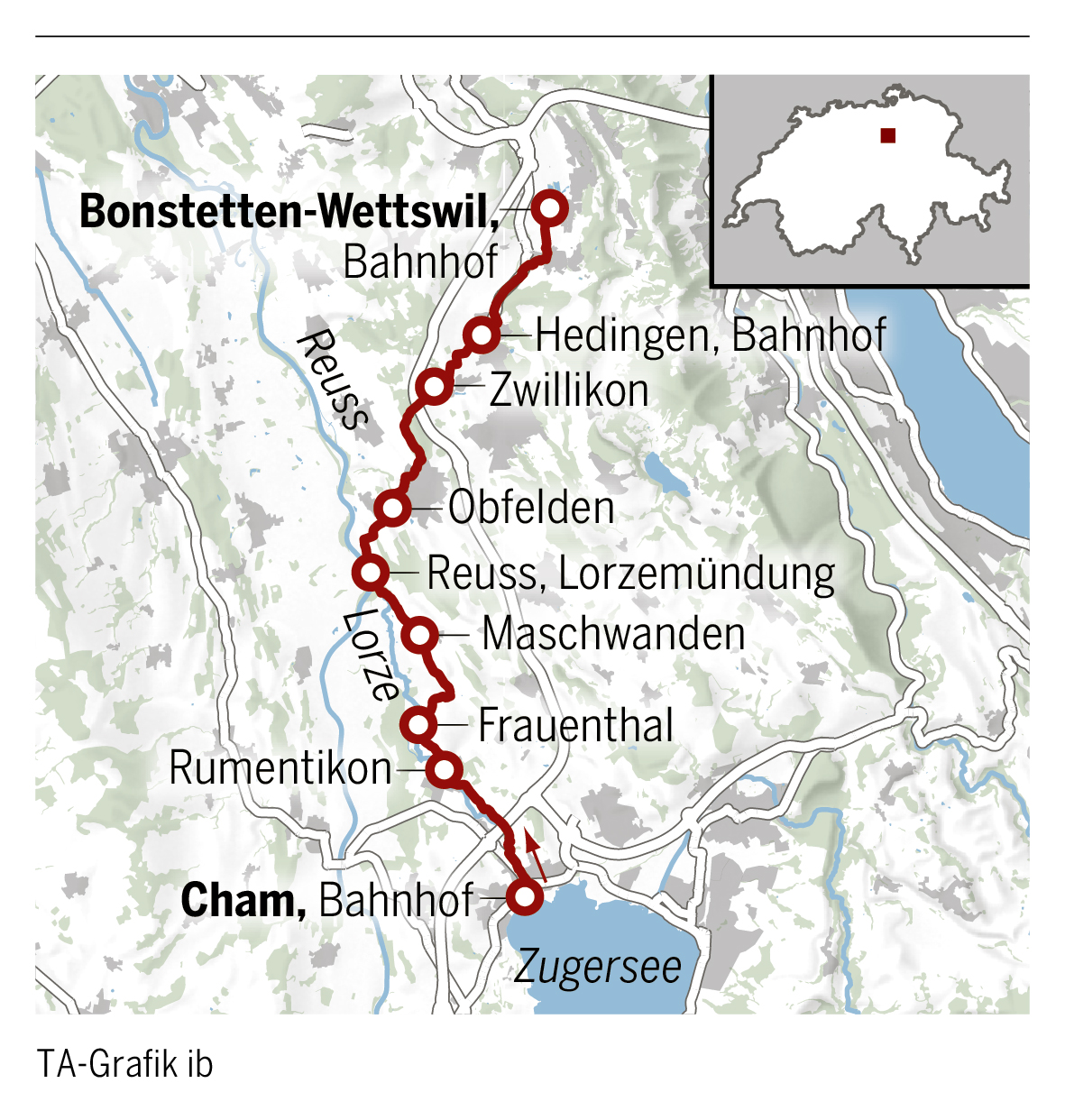Diese Woche an der Aare von Rupperswil nach Schinznach-Bad (AG)
Vor wenigen Wochen beschrieb ich – mit Begeisterung – die Route von Aarau nach Rupperswil samt den Auen am Weg. Hier die damals versprochene Fortsetzung, es geht von Rupperswil die Aare entlang nach Schinznach-Bad, und wieder geraten wir in die Auen. Ebenso eindrücklich sind auf der Strecke die vielen Übergänge und Stege.
Es beginnt schon in Rupperswil auf dem Weg vom Bahnhof zur Aare. Wir queren bei der alten Spinnerei in einer gedeckten Holzbrücke einen Industriekanal. Gleich danach die Autobrücke Richtung Auenstein. Wir nehmen sie, biegen dann gleich ab auf eine Insel so lang und schmal wie ein Zahnstocher.
Die Zahnstocherplattform
Der erste Höhepunkt gleich danach: eine hölzerne Plattform, von der wir über das Wasser Richtung Rupperswil blicken, vor allem aber die nahe Fluss- und Ufergegend mit Landflecken sehen, die immer mal überflutet werden. Winterlich kahl das Ambiente, braunes Kraut allenthalben, darauf Schwemmholz.
Gleich wieder ein Höhepunkt ist etwas später der lange Fussgängersteg, der am Ende der Zahnstocherinsel wieder aufs südseitige Festland führt. Es handelt sich um eine Spannbandbrücke: Zwei Stahlbänder, in den Fundamenten verankert, ziehen sich über den Fluss und tragen – Träger gibt es nicht – den Steg mit den Verstrebungen.
Der Steg schwankt beim Begehen sanft. Man erlaube den Kalauer: Was würde man sagen, wenn er kaputtginge? Bänderriss!
Crowdfunding für Steg
Immer schön die Aare entlang, an deren Uferbäumen sich Biberspuren zeigen, kommen wir nach Wildegg. Gigantisch das Areal der Zementfabrik und ihre Bauten. Schloss Wildegg auf seinem Geländesporn überwacht das Gelände aus erhabener Warte. Im 13. Jahrhundert von Dienstherren der Habsburger errichtet, gehört es heute dem Kanton Aargau und ist speziell bekannt für seine Gartenanlagen.
Eine der vielen Brücken gehört auf jeden Fall noch erwähnt. Einige Zeit nach Wildegg kommt ein Fussgängersteg in Sicht, der hinüber Richtung Veltheim führt. Er ist seit 2008 gesperrt, soll aber diesen Herbst wieder eröffnet werden. Möglich ist das durch ein kürzlich abgeschlossenes Crowdfunding. Es brachte 40’000 Franken ein, mehr als genug, um die Sanierung vorzunehmen, an die die öffentliche Hand 70’000 Franken beisteuert.
Notabene war dies – wenigstens dem Schild am Fuss des Stegs zufolge – die erste Geldsammlung nach dem Schwarmprinzip für ein Stück öffentliche Infrastruktur in der Schweiz.
Wanderknochen baden
Einige Zeit später zieht der Wanderweg länger weg von der Aare, die wir gleich vermissen. Eingangs Schinznach-Bad sind wir wieder bei ihr und begleiten sie noch ein Stück bis zum Abzweiger hinauf zum Bahnhof. Dort gibt es Möglichkeiten. Die eine: heimfahren. Die andere: essen. Im Restaurant Bahnhöfli kocht man vorzüglich, allerdings ist es bloss am Donnerstag offen. Ein Stück weiter gibt es ja aber auch das Bad Schinznach mit mehreren Einkehrmöglichkeiten. Die Wanderknochen heiss baden können wir dort auch.
Eine weitere Variante ist die: Wir investieren noch einmal knappe zwei Stunden und folgen dem Fluss weiter bis Brugg. Auch diese Strecke ist sehr zu empfehlen. Wetten, dass niemand es schafft, sich am Schluss in Brugg an alle Brücken, die er oder sie gesehen hat, zu erinnern und in der richtigen Reihenfolge aufzulisten?
++
Route: Rupperswil, Bahnhof – Aare, Insel – Spannbandbrücke – Wildegg – Schinznach-Bad, Bahnhof.
Wanderzeit: 2 1/4 Stunden.
Höhendifferenz: Praktisch keine.
Wanderkarte: Aargau 1:60 000 von Kümmerly-Frey. Auf ihr ist das ganze Stück Aarau–Brugg abgebildet.
GPX-Datei: Hier downloaden.
Länger: Schon in Aarau starten, wie in einer früheren Wanderkolumne beschrieben, zusätzlich 2 1/4 Stunden. Oder von Schinznach-Bad der Aare weiterfolgen bis Brugg, zusätzlich 1 3/4 Stunden.
Charakter: Angenehmes Geradeausgehen. Viel Natur und dazu immer wieder interessante Brücken und Installationen, die die Wasserkraft nutzen.
Höhepunkte: Der Blick von der Plattform auf dem Inseli bei Rupperswil auf die Aare und ihre Auen. Die elegante Spannbandbrücke. Der Anblick von Schloss Wildegg.
Kinder: Gute, weil nicht zu weite Strecke. Am Wasser muss man die Kinder beaufsichtigen.
Hund: Bestens geeignet.
Einkehr: In Rupperswil. In Schinznach-Bad hat das Bahnhöfli – reservieren! – nur am Donnerstag offen. Etwas weiter kann man im Bad Schinznach einkehren (und heiss baden).
Tipp: Das Naturama in Aarau widmet sich den Aargauer Auenlandschaften.
Wanderblog: Täglich ein Eintrag auf Thomas Widmers privatem Journal.
++
Der Beitrag Bänderriss, haha erschien zuerst auf Outdoor.